
Das Verhältnis von Kirche und Politik ist nicht nur ein Dauerbrenner im gesellschaftlichen Diskurs in einem demokratischen Staat wie der gegenwärtigen Bundesrepublik. Entlang der zahlreichen (gesellschafts-)politischen Umbrüche im 20. und frühen 21. Jahrhundert gehört die Frage nach der Handlungsrelevanz des Christseins kontinuierlich auch zur theologischen Selbstreflexion der Kirche. Die kirchlichen Auseinandersetzungen in der frühen Weimarer Republik, vor und während der nationalsozialistischen Herrschaftsübernahme 1930-31, zur Frage nach der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik und den sozialen Aufbrüchen der „68er“ oder dem Fall der Mauer bieten breites Material, um an unterschiedlichen historischen Brennpunkten exemplarisch verschiedene theologische Positionierungen ebenso wie konkrete Handlungsweisen im und gegenüber dem Raum des Politischen zu analysieren und kritisch zu diskutieren sowie fallweise Unterrichtsbezüge im Sinne einer „politischen Religionspädagogik“ anzudenken.
- Alkier, Stefan u.a. (Hg.): Evangelische Kirchen und Politik in Deutschland. Konstellationen im 20. Jahrhundert, Tübingen 2023
- Hermle, Siegfried / Oelker, Harry (Hg.): Kirchliche Zeitgeschichte_evangelisch, Bde. 1-4, 2019-2023
- Leonhardt, Rochus: Religion und Politik im Christentum. Vergangenheit und Gegenwart eines spannungsreichen Verhältnisses, Baden-Baden 2017
- Schlag, Thomas: Horizonte demokratischer Bildung. Evangelische Religionspädagogik in politischer Perspektive, Frankfurt 2010
- Dozent*in: Christopher König

Der Pietismus lässt sich als eine der wichtigsten Reformbewegungen nach der Reformation im frühneuzeitlichen Europa betrachten. Als Frömmigkeitsbewegung hat der Pietismus die protestantischen Theologien des 18. Jahrhunderts nachhaltig geprägt, dabei aber auch soziale, künstlerische und bildungsgeschichtliche Impulse gesetzt, deren Relevanz weit über seine kirchengeschichtliche Bedeutung hinausgehen. Anknüpfend an bildungsreformerische Ansätze des 17. Jahrhunderts entwickelte der Theologe August Hermann Francke im Halleschen Waisenhaus ein ausstrahlungsstarkes pädagogisches Modellprojekt, das in diesem Seminar den Ausgangspunkt bieten soll, um u.a. anhand von Quellentexten pädagogische, erzieherische und religiöse Leitvorstellungen im Pietismus zu erarbeiten.
Literaturhinweise:
- Albrecht-Birkner, Veronika, u.a. (Hg.): Pietismus. Eine Anthologie von Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts, Leipzig 2017
- Breul, Wolfgang/Hahn-Bruckart, Thomas (Hg.): Pietismus Handbuch, Tübingen 2021
- Jacobi, Juliane (Hg.): Zwischen christlicher Tradition und Aufbruch in die Moderne. Das Hallesche Waisenhaus im bildungsgeschichtlichen Kontext, Tübingen: Niemeyer 2007
- Neumann, Josef/Sträter, Udo (Hg.): Das Kind in Pietismus und Aufklärung, Tübingen 2000
- Oberschelp, Axel: Das Hallesche Waisenhaus und seine Lehrer im 18. Jahrhundert. Lernen und Lehren im Kontext einer frühneuzeitlichen Bildungskonzeption, Tübingen 2006
- Dozent*in: Christopher König

Der Begriff der „Tugend“ erscheint auf den ersten Blick etwas altmodisch. Tugendethische Perspektiven erhalten aber in der zeitgenössischen Diskussion zwischen Theologie und Philosophie wieder neues Interesse, was vielleicht mit dem Auseinandertreten ethischer Normen und der Frage nach dem Sinn des Lebens – nach dem Glück – zusammenhängt. In diesem Seminar werden zunächst in einem theologie- und ideengeschichtlichen Einstieg prominente Denker wie Aristoteles, Augustinus oder Thomas von Aquin in den Blick genommen, die sich auf das Begriffsfeld der „Tugend“ bezogen haben. Sie werden dann mit zeitgenössischen Ansätzen ins Gespräch gebracht, um die Relevanz von personalen Haltungen wie Aufrichtigkeit, Achtung, Liebe, Mitgefühl zu diskutieren.
- Gronemeyer, Reimer: Tugend. Über das, was uns Halt gibt, Hamburg 2019
- Halbig, Christoph / Felix Timmermann (Hg.): Handbuch Tugend und Tugendethik, Wiesbaden 2021
- Pelluchon, Corine: Ethik der Wertschätzung. Tugenden für eine ungewisse Welt, Darmstadt 2019
- Schmidt, Jochen: Was wir uns schulden. Freiheit und Pflichten gegenüber sich selbst, Baden-Baden 2022
- Dozent*in: Christopher König
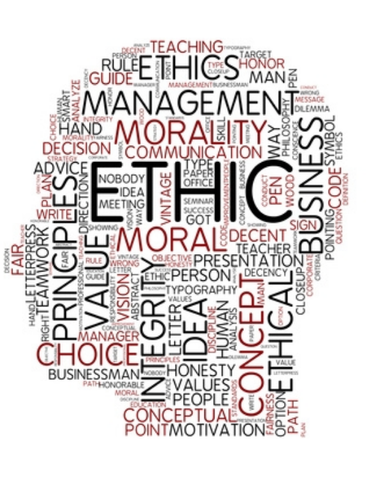
Was ist gut? Was ist richtig? Was ist gerecht? Nach welchen Kriterien soll ich mein Handeln ausrichten? Das sind Themen der Ethik als einer Disziplin zwischen Theologie und Philosophie, die danach fragt, wie sich christliche Identität und christliches Handeln in gesellschaftlichen Zusammenhängen oder konkreten Entscheidungssituationen realisiert.
In dieser Einführungsveranstaltungen werden wichtige ethische Entwürfe und grundlegende Denkformen aus der christlichen Tradition erarbeitet und exemplarisch an aktuellen Fragestellungen erprobt.
- Fischer, Johannes u.a.: Grundkurs Ethik. Grundbegriffe philosophier und theologischer Ethik, Stuttgart 2008
- Huber, Wolfgang: Ethik: Die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod, München 2015
- Leonhardt, Rochus: Ethik, Leipzig 2022
- Dozent*in: Christopher König

1524/25 ereignete sich in weiten Teilen von Deutschland sowie der Schweiz eine Folge von Aufständen, an die 2025 u.a. unter der Überschrift „500 Jahre Bauernkrieg“ erinnert wird. Die Auseinandersetzungen hatten soziale und ökonomische Ursachen. Doch beriefen sich die Aufständischen auch auf Vorstellungen der frühen Reformation, etwa in den Memminger „12 Artikeln“, die sich als frühe Formulierung grundlegender Menschen- und Freiheitsrechte lesen lassen. Dieses Proseminar führt anhand ausgewählter Quellentexte in den Ereigniszusammenhang „Bauernkriege“ sowie in (kirchen-)historische Methoden und Arbeitsformen ein. Anhand von Themenfeldern wie „Protest“ oder „Menschenrechte“ werden exemplarische Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen hergestellt.
- Peter Blickle: Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, München 2024
- Peter Blicke: Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten: Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland, München 2006
- Siegfried Bräuer / Günter Vogler: Thomas Müntzer: Neu Ordnung machen in der Welt. Eine Biographie, Gütersloh 2024
- Thomas Kaufmann: Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis, Freiburg 2024
- Lyndal Roper: Für die Freiheit. Der Bauernkrieg 1525, Frankfurt am Main 2024
- Gerd Schwerhoff: Der Bauernkrieg. Eine wilde Handlung. Beck, München 2024
- Dozent*in: Christopher König
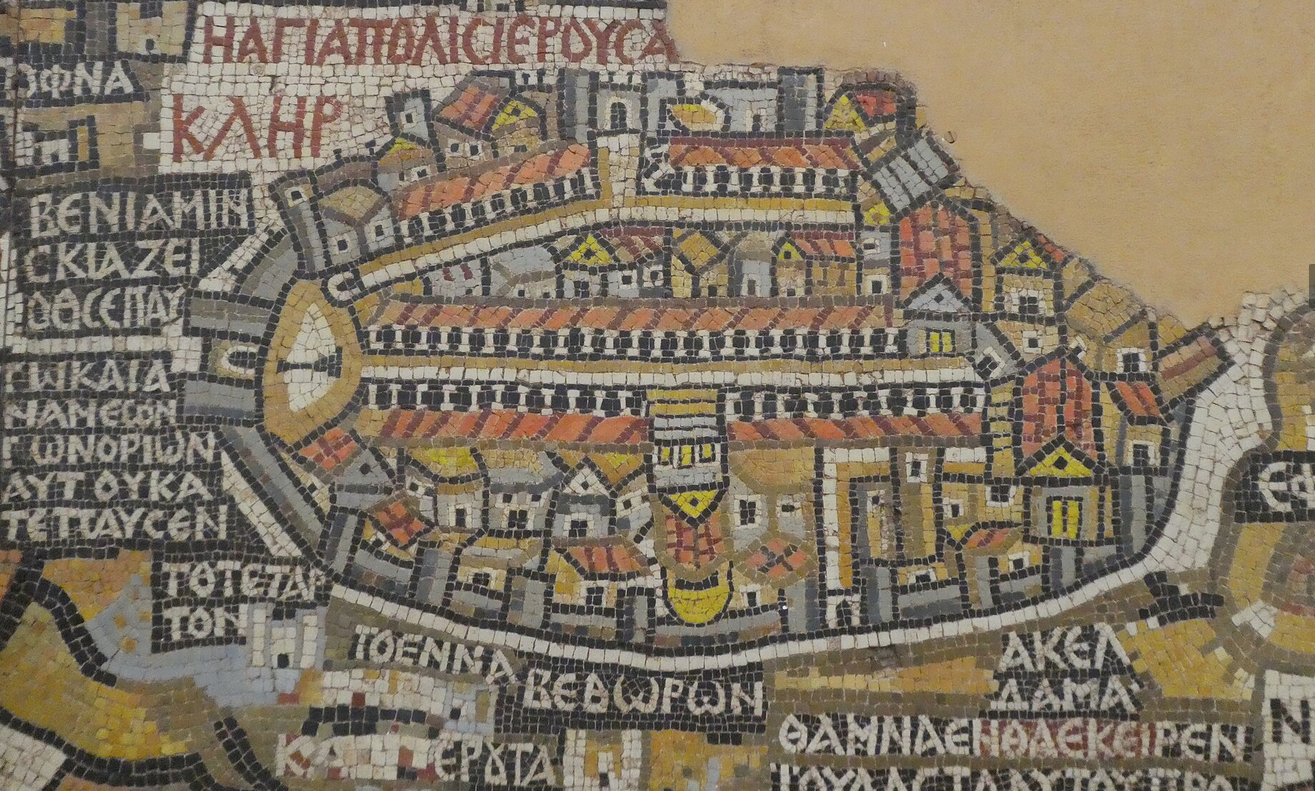
Kirche und Theologie sind nicht einfach da, sie verändern sich über die Zeit – sie haben ihre Geschichte. Diese Einführungsveranstaltung stellt Grundzüge der Geschichte des Christentums in ihren Epochen und entlang von Kernfragen vor. Zudem wird in Methoden des historischen Arbeitens eingeführt. Dabei soll deutlich werden, was Geschichte und historisches Denken eigentlich sind und welche Relevanz das für die Theologie als Wissenschaft besitzt.
- Dierk, Heidrun: Gott und die Kirchen. Orientierungswissen Historische Theologie, Stuttgart 2015
- Emich, Birgit: Geschichte der Frühen Neuzeit (1500-1800) studieren, München 2019
- Jung, Martin: Kirchengeschichte, Tübingen 2022
- Jammerthal, Tobias, u.a.: Methodik der Kirchengeschichte. Ein Lehrbuch, Tübingen 2022
- Kaufmann, Thomas u.a.: Ökumenische Kirchengeschichte, 3 Bde., Darmstadt 2008ff.
- Dozent*in: Christopher König

Was hat das Fach Theologie an einer Universität oder Hochschule zu
suchen? Wieso heißt das Fach „Theologie“ und nicht „Religion“? Wie hängen die
einzelnen Fächer der Theologie untereinander zusammen? Wie geht
wissenschaftliches Arbeiten in der Theologie, und welche Hilfsmittel gibt es?
Diese und weitere Fragen werden in dieser Einführungsveranstaltung diskutiert,
an einzelnen Entwürfen aus Geschichte und Gegenwart erkundet und (soweit
möglich) an praktischen Beispielen ausprobiert.
- Dozent*in: Christopher König
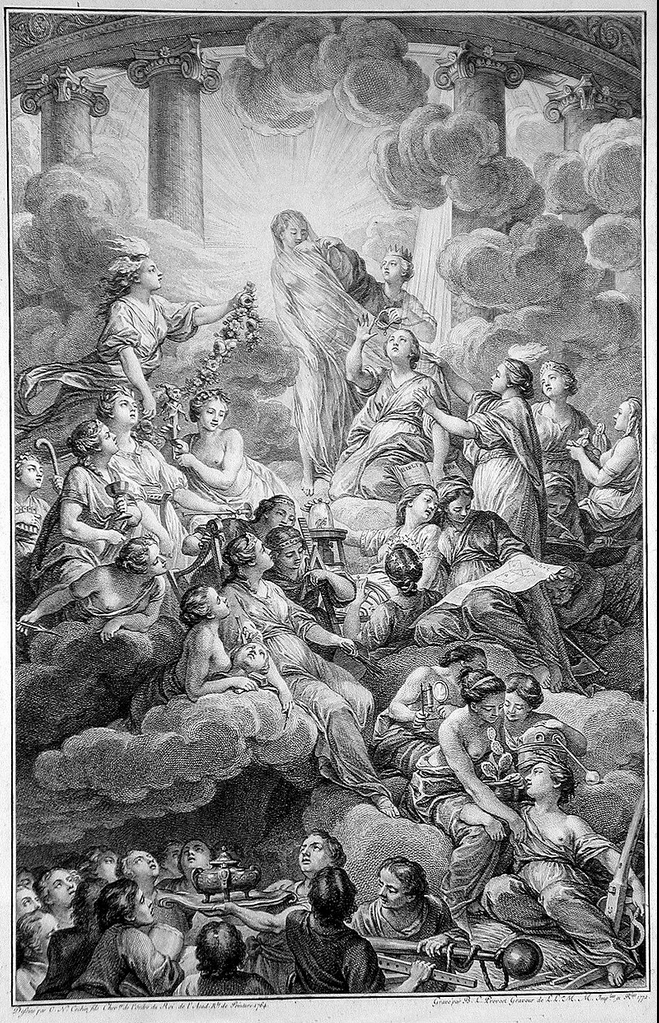
„Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss“, meinte der Philosoph Immanuel Kant am Ende der Epoche, die in diesem Seminar in den Blick genommen wird. Seine Äußerung bezog sich auch auf die Religion, die gemeinsam mit allen anderen Daseinsbereichen in der Aufklärung einer vernunftgemäßen Kritik unterzogen werden sollte, und zwar mit Blick auf ihre Institutionen, ihre Gottesvorstellungen und ihre Erkenntnisweisen. Ausgewählte religions- und theologiekritische Texte und Entwürfe des späten 17. und v.a. des 18. Jahrhunderts werden in diesem Seminar eingehend und in ihrem jeweiligen Gesprächs- und Rezeptionskontext diskutiert und auf ihre Relevanz in aktuellen Diskursen befragt.
- Beutel, Albrecht: Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklärung: Ein Kompendium, Stuttgart 2009
- Israel, Jonathan: Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford 2002
- Kirn, Hans-Martin: Pietismus und Aufklärung, Stuttgart 2019
- Kühnlein, Michael: Religionsphilosophie und Religionskritik. Ein Handbuch, Berlin 2018
- Tricoire, Damien: Aufklärung, Köln 2023
- Weinrich, Michael: Religion und Religionskritik. Ein Arbeitsbuch, Göttingen 2011
- Dozent*in: Christopher König
